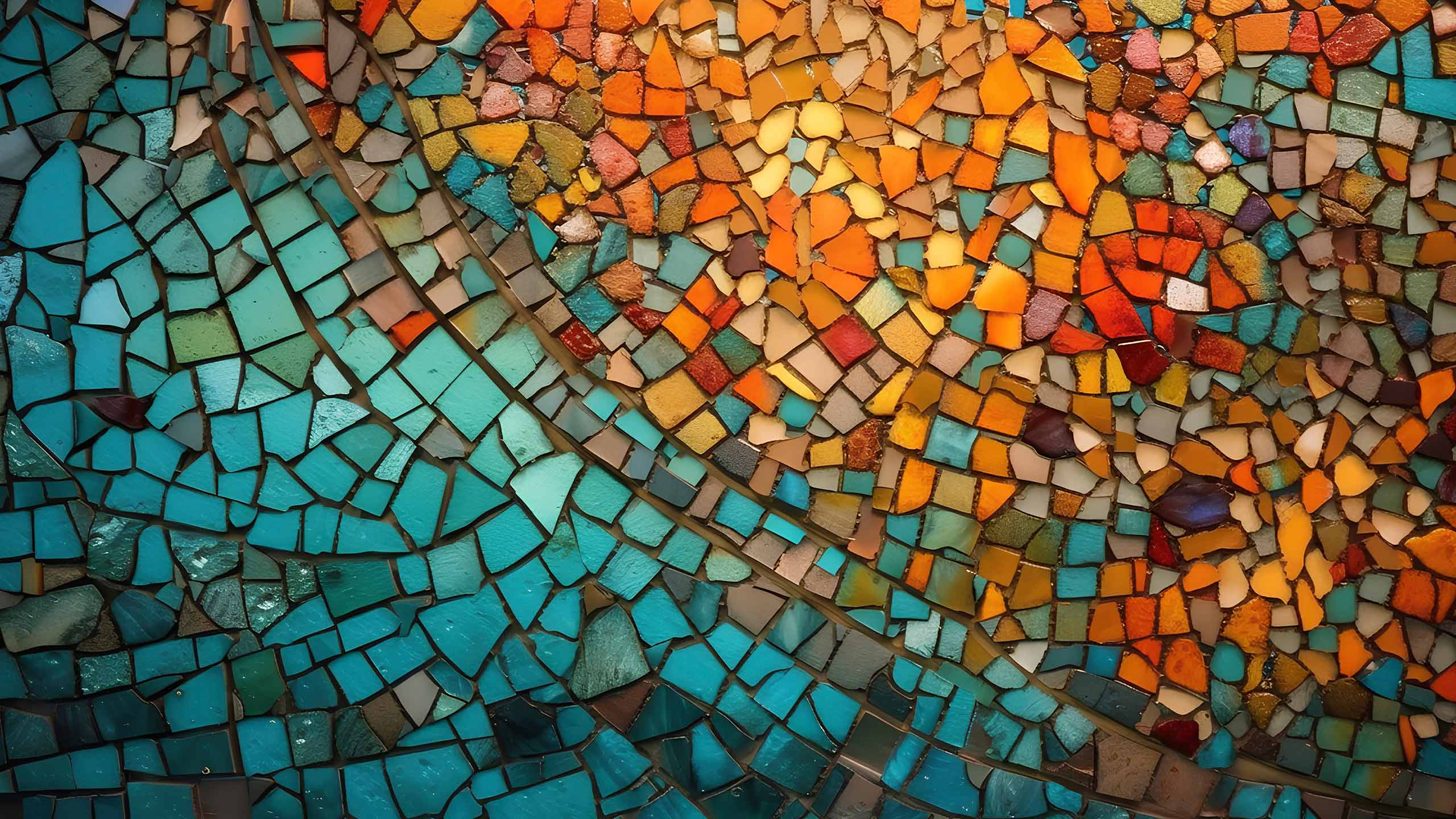Langfristtrend: Die Zeit der Fragmentierung
In unserem langfristigen Ausblick 2024 mit dem Titel „Anleihenrenditen im Vorteil“ haben wir argumentiert, dass die Zentralbanken die Inflation weitgehend eingedämmt hätten und bald mit Zinssenkungen beginnen würden. Wir haben geschrieben, dass sich die Risiken weg von Wachstum und Inflation und hin zu hohen Bewertungen von Risikoanlagen verlagern. Und wir haben davor gewarnt, dass die US-Verschuldung auf einem unhaltbaren Weg sei. Wir haben hervorgehoben, dass der Inflationsschock und der Zinserhöhungszyklus nach der Pandemie zu einem generationsübergreifenden Anstieg der Anleihenrenditen geführt haben – von den historischen Tiefstständen der 2010er-Jahre auf ein Niveau, das einen robusten Ausblick für globale festverzinsliche Wertpapiere über gleich mehrere Jahre hinweg stützt.
Auf die Gefahr hin zu untertreiben: Es hat sich in den vergangenen zwölf Monaten viel getan:
- Trump 2.0: eine beispiellose Agenda zur Neuausrichtung der US-amerikanischen Finanz-, Regulierungs-, Einwanderungs- sowie der nationalen Sicherheits- und Handelspolitik.
- Die Zentralbanken der Industrieländer haben begonnen, die Leitzinsen zu senken. Aber Themen wie eine globale weiche Landung, die Ausnahmestellung der USA und die Disinflation sind angesichts eines aufkeimenden Handelskriegs in den Hintergrund gedrängt worden.
- Die Wahlen in Deutschland haben eine unvorhergesehene finanz- und verteidigungspolitische Kehrtwende ausgelöst.
Kurz gesagt: Die traditionelle Weltordnung, in der die Wirtschaft die Politik geprägt hat, wurde auf den Kopf gestellt. Die Politik treibt jetzt die Wirtschaft vor sich her, vor allem in den USA und zunehmend auch in der Art und Weise, wie andere Länder darauf reagieren.
Die Fragmentierung von Handels- und Sicherheitsbündnissen wird wahrscheinlich zu einem unabhängigen Treiber von Gewinnern und Verlierern, Konjunkturzyklen und Marktvolatilität werden. Darüber hinaus sind Industrien, die von der nationalen Politik begünstigt werden, jetzt wieder im Spiel, weil andere Regierungen am Drücker sind und sich regionale Prioritäten verändert haben. Das zeigt sich etwa in der Hinwendung der USA zu fossilen Brennstoffen und Autos sowie in Europas neuem Fokus auf Verteidigung.
Zu unseren Gastrednern beim Secular Forum gehörten in diesem Jahr Robert Lighthizer, ehemaliger US-Handelsbeauftragter in der ersten Trump-Regierung, Roberto Campos Neto, ehemaliger Präsident der brasilianischen Zentralbank, und Daron Acemoglu, Wirtschaftsprofessor am MIT und Nobelpreisträger (die vollständige Liste der Gastredner und Mitglieder des Global Advisory Board finden Sie hier).
Handelskriege und die Zukunft des US-Dollars
Obschon rechtliche Anfechtungen der US-Zölle, wenn sie denn erfolgreich sind, den sich entwickelnden Handelskrieg entschärfen könnten, glauben wir, dass die harten Handelskonflikte anhalten werden. Die Unsicherheit über das „Endspiel“ in der Handelspolitik und die Zukunft der globalen Sicherheitsbündnisse haben die Abwärtsrisiken für das globale Wachstum akzentuiert.
Ohne nachhaltige Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA senkt der Handelskrieg vor allem die Exportnachfrage, was für einen Großteil der Welt desinflationäre Auswirkungen haben wird. Die Umverteilung des chinesischen Handelsüberschusses auf den Rest der Welt ist eindeutig eine Quelle für desinflationäre Risiken. Im Gegensatz dazu sind die Inflationsrisiken in den USA zumindest kurzfristig gestiegen, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Divergenz zwischen den USA und anderen Ländern.
Trotz der jüngsten Abwertung des US-Dollars halten wir es für nahezu unmöglich, dass der Dollar langfristig seinen Status als dominante globale Reservewährung verliert. Das liegt unter anderem daran, dass es auf den Märkten für Devisen, Fremdwährungsschulden und Bankkredite an erst zu nehmenden Konkurrenten mangelt. Das US-Finanzministerium beteuert immer noch, einen starken Dollar zu wollen, und die US-Regierung scheint von der Idee eines Mar-a-Lago-Abkommens abzurücken, das darauf abzielt, den Dollar zu schwächen.
Aber Dollar-Bärenmärkte sind sowohl kurz- als auch langfristig möglich, da sie historische mehrjährige Dollarzyklen widerspiegeln. Sich verändernde politische und sicherheitspolitische Prioritäten könnten die relative globale Nachfrage nach US-Assets und anderen Vermögenswerten beeinflussen – insbesondere dann, wenn ausländische Anleger ihre Toleranz für nicht abgesicherte US-Dollar-Engagements neu bewerten.
Wir gehen davon aus, dass der US-Dollar weiterhin Marktanteile im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr verlieren wird, da regionale Währungsvereinbarungen (zum Beispiel die von China entwickelte Zahlungsplattform mBridge) in einer stärker fragmentierten Welt ausgeweitet und vertieft werden. Die allmähliche Abkehr vom US-Dollar könnte sich fortsetzen, da globale Portfolios an ihren Rändern neu gewichtet werden und sie zu einer stärker diversifizierten Allokation in Risikoanlagen übergehen.
Die Verschuldung wiegt schwer
Obwohl sie sich in der Nähe neuer Rekordhöhen befindet, bleibt die Verschuldung in den meisten Industrieländern tragfähig. Zu den bemerkenswerten Ausnahmen gehören Japan, die USA und Frankreich, wo das Schuldenniveau einem langfristig nicht mehr nachhaltigen Aufwärtstrend folgt und sogar noch stärker wächst als im Vorjahr (siehe Abbildung 1). Die Defizite dürften über dem Niveau vor der Pandemie bleiben, was zum Teil auf die steigenden Zinskosten zurückzuführen ist.
Diese Probleme scheinen jedoch eher chronisch als akut zu sein. Wir rechnen nicht mit einer plötzlichen Finanzkrise, sondern mit einer episodischen Marktvolatilität – wie sie in den USA in den Jahren 2023 und 2025 und in Großbritannien im Jahr 2022 sogar noch prononcierter zu beobachten war. In unserem Basisszenario bleiben US-Staatsanleihen auf lange Sicht das „sauberste schmutzige“ Hemd im Schrank der Staatsanleihen, untermauert durch den Status des US-Dollars als Reservewährung.
Die Fiskalpolitik in den USA, Deutschland und einigen anderen entwickelten Volkswirtschaften könnte weniger restriktiv ausfallen, als wir es vor einem Jahr prognostiziert hatten. Das Trump-2.0-Fiskalpaket wird wahrscheinlich die Defizite und Schulden der USA über die bisherigen Prognosen hinaus ausweiten. Insgesamt bleibt der fiskalische Spielraum begrenzt – und damit auch das Potenzial, auf künftige Abschwünge reagieren zu können. Allerdings haben die Zentralbanken viel mehr Spielraum für Zinssenkungen als in den zehn Jahren vor der Pandemie.
Trotz einiger kurzfristiger Anstiege infolge der Zölle gehen wir davon aus, dass die Inflation langfristig wieder auf das Zielniveau der Fed zurückkehren wird. Wir erwarten, dass die Fed die Zinsen auf den neutralen Wert (rund drei Prozent) senken wird – im Fall einer Rezession auch deutlich unter den neutralen Wert, notfalls auch auf null Prozent.
Die historische Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA über einen Zeitraum von fünf Jahren liegt bei etwa zwei Dritteln. Allerdings dürfte die Wahrscheinlichkeit in den kommenden fünf Jahren vor dem aktuellen Hintergrund höher sein.
Die globalen Wirtschafts- und Inflationsaussichten verändern sich
Lässt man die USA außen vor, stehen die großen Volkswirtschaften der Industrieländer vor ausgeprägten Wachstumsherausforderungen. Die Schwellenländer hingegen werden durch ein umsichtiges Schuldenmanagement gestützt, aber auch sie werden von globalen Veränderungen im Handel und der Politik der Industrieländer beeinflusst.
Europa
Das Wachstum in der Eurozone könnte sich in den kommenden fünf Jahren von rund 1,0 Prozent vor der Pandemie auf etwa 0,5 Prozent abschwächen, was auch eine Folge demografischer Trends und des langsameren Produktivitätswachstums ist. Die Region hinkt im globalen Technologierennen hinterher, sieht sich einer harten Konkurrenz aus China ausgesetzt und kämpft mit hohen Energiekosten in einem ungünstigeren Handelsumfeld. Deutschlands Hinwendung zu höheren Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben ist signifikant, dürfte aber wahrscheinlich von anderen Staaten Europas nicht erreicht werden.
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Inflation aufgrund der Deglobalisierung und höherer Inflationserwartungen auf die Ein-Prozent-Norm vor der Pandemie zurückkehren wird. Dennoch dürfte sie sich wahrscheinlich unterhalb des Ziels der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent einpendeln. Die neutralen Zinsen dürften tief bleiben und unter dem aktuellen nominalen Niveau von rund zwei Prozent liegen.
China
Chinas Wirtschaft begibt sich angesichts steigender Verschuldung und negativ wirkender demografischer Trends auf einen Pfad mit niedrigeren Wachstumsraten. Ehemalige Wachstumstreiber – Immobilien- und Infrastrukturausgaben – weichen einer Politik, die Konsum, Produktion und Technologie ankurbelt, was einen bewussten Schwenk von einem von Schulden getriebenen Boom hin zu nachhaltigem, innovationsgetriebenem Wachstum signalisiert.
Der Deflationsdruck und strukturelle Zwänge deuten jedoch darauf hin, dass das Wachstum insgesamt langsamer verlaufen wird. China bleibt ein globales Produktionszentrum. Handels- und geopolitische Spannungen lassen jedoch Zweifel an Exporten als verlässlichen Wachstumsmotor aufkommen.
Schwellenländer
Die Frage, ob sich neue Risiken, die von den USA ausgehen, automatisch in höheren Risikoprämien für den Rest der Welt niederschlagen, unterstreicht, wie eng der historische Zusammenhang zwischen den Leitzinsen der Industrieländer und den Kreditkosten der Schwellenländer sein kann. Während die Risiken offensichtlich sind, ist positiv zu vermerken, dass viele Schwellenländer ihre Verschuldung auf einem überschaubaren Niveau gehalten haben und somit in der Lage sind, potenziellem Gegenwind zu trotzen.
Der Aufstieg digitaler Währungen – einschließlich Stablecoin-Emittenten, die immer größere Portfolios von US-Staatsanleihen halten – zeigt, wie schnell Kapitalströme entstehen können. Wenn dieses Ökosystem ausgereift ist, könnte es die Kapitalflüsse und das Währungsmanagement der Schwellenländer neu gestalten.
Mögliche Störungen des Basisszenarios
Wir sind wachsam gegenüber potenziellen Störungen, die – obwohl es sich aus unserer Sicht um Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit handelt – unseren langfristigen Basisausblick grundlegend erschüttern könnten. Dazu zählen:
- Beschleunigte KI-bedingte Disruption Die Fortschritte bei der KI könnten schneller als erwartet kommen und sich in einem schnelleren und höheren Wachstum der BIP- und Produktivitätsdaten niederschlagen. Unser Basisszenario geht jedoch nach wie vor davon aus, dass sich die volle Wirkung der neuen großen KI-Sprachmodelle nicht plötzlich, sondern graduell manifestieren wird.
- Ein Verlust der Glaubwürdigkeit der Fed – der auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs oder einen Notenbanker der Fed zurückzuführen ist, der nicht bereit ist, die Preisstabilität zu wahren – ist zwar unwahrscheinlich, wäre aber schwerwiegend und würde wahrscheinlich einen Anstieg der Inflationserwartungen und Anleihenrenditen, eine starke Abwertung des US-Dollars und einen Ausverkauf bei Risikoanlagen auf breiter Basis auslösen.
- USA: Ausnahmestellung 2.0 Das Narrativ der Outperformance der USA in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen im Vergleich zum Rest der Welt ist in diesem Jahr verblasst. Dennoch sind die USA in das Jahr 2025 mit starken Produktivitätsdaten, Technologieführerschaft und robusten Kapitalmärkten, die zu einem stetigen Gewinnwachstum führten, gestartet. Da das BIP-Wachstum der USA das der Konkurrenten um mindestens einen Prozentpunkt übertrifft, könnten diese Vorteile Bestand haben. Wenn die handels- und fiskalpolitischen Unsicherheiten nachlassen, könnte die Ausnahmestellung der USA eine Renaissance erleben.
Anlageimplikationen: Festverzinsliche Wertpapiere für eine fragmentierte Zeit
Bei festverzinslichen Wertpapieren zahlt es sich aus, widerstandsfähige Portfolios aufzubauen. Wir plädieren weiterhin dafür, den Renditevorteil bei qualitativ hochwertigen Anleihen zu nutzen, anstatt Aktien mit hohen Bewertungen hinterherzujagen.
Die Risikoprämie bei Aktien – die Differenz zwischen Aktien- und Anleihenrenditen – dürfte der wichtigste Bestandteil der Asset-Allokation sein, da sie den relativen Wert von Aktien und Anleihen misst. Der einfachste Weg, die Prämie zu berechnen, besteht darin, die reale (inflationsbereinigte) Anleihenrendite von der zyklisch bereinigten Gewinnrendite abzuziehen. Wie die Grafik in Abbildung 2 zeigt, liegt die Risikoprämie für US-Aktien bei null, womit sie im historischen Vergleich außergewöhnlich niedrig ist.
Eine Rückkehr zu höheren Risikoprämien bei Aktien geht typischerweise mit einer Rally bei Anleihen, einem Ausverkauf von Aktien oder beidem einher. Dieselbe Grafik zeigt zwei frühere Zeiträume, in denen die Prämie bei null lag oder negativ war: 1987 und 1996 bis 2001. Nachdem die Aktienrisikoprämie im September 1987 bei null lag, brach der Aktienmarkt um fast 25 Prozent ein, während die realen Renditen 30-jähriger Anleihen um 80 Basispunkte (Bp) einknickten. Im Dezember 1999 sackte die Aktienrisikoprämie auf ihren niedrigsten Stand im Betrachtungszeitraum, woraufhin die Aktienkurse bis Februar 2003 um knapp 40 Prozent sanken. Im gleichen Zeitraum gaben die realen Renditen 30-jähriger Anleihen um etwa 200 Basispunkte nach.
Darüber hinaus befinden sich die Unternehmensgewinne im Verhältnis zum BIP in der Nähe historischer Höchststände. Steigende Zölle und geopolitische Spannungen könnten die zukünftigen Gewinne belasten.
Der Renditevorteil bei Anleihen bleibt überzeugend
Die Bewertungen deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Outperformance von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren geringer ist, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Aussichten für qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere so gut sind wie schon lange nicht mehr. Nach den deutlichen Zinserhöhungen infolge der Pandemie haben die Anleihenmärkte es auf die Sonnenseite geschafft: Anleger können nun von höheren Renditen und einem möglichen Kursanstieg profitieren, da die Zentralbanken über ausreichend Spielraum für Zinssenkungen verfügen.
Die Prognose der Erträge von festverzinslichen Wertpapieren ist relativ einfach: Über einen langfristigen Horizont kann die Anfangsrendite eines Anleihenportfolios ein guter Anhaltspunkt für die erwarteten Erträge sein (siehe Abbildung 3). Die Renditen des Bloomberg U.S. Aggregate Index und des Global Aggregate Index (in US-Dollar abgesichert), zwei gängigen Benchmarks für qualitativ hochwertige Anleihen, liegen zum 5. Juni 2025 bei rund 4,74 beziehungsweise bei 4,94 Prozent.
Von dort aus können aktive Manager versuchen, Portfolios zusammenzustellen, die eine Rendite von etwa fünf bis sieben Prozent bringen, indem sie von attraktiven Renditen profitieren, die in qualitativ hochwertigen Anlagen stecken. Wir gehen davon aus, dass wir uns weiterhin auf eine hohe Qualität konzentrieren werden.
Globale Chancen mit aktiven Strategien nutzen
Mächtige, langfristig wirkende Kräfte – die Einführung lokaler Währungen, eine disziplinierte Finanzpolitik und diversifizierte Finanzierungen – schaffen Konvergenzen und dadurch dauerhaft Chancen. Ein aktives Management, das sich länderspezifische Nuancen und Relative-Value-Differenzen zunutze macht, ist entscheidend, die unvermeidliche Volatilität im Griff zu haben.
Die Chancen, Alpha zu generieren – also Erträge, die über den Markt-Benchmarks liegen –, sind auf den globalen Märkten so groß wie nie zuvor (siehe Abbildung 4).
Viele Volkswirtschaften der Industrieländer bieten eine Kombination aus attraktiven Anleihenrenditen und wenig rosigen Konjunkturaussichten, was für Anleihenanleger jedoch von Vorteil sein kann. Darüber hinaus sehen wir, dass die Schwellenländer auf ihrer nachgewiesenen Widerstandsfähigkeit aufbauen. In der Vergangenheit hat globale Diversifikation überdurchschnittliche um die Volatilität bereinigte Erträge gegenüber Portfolios einzelner Länder geboten. Wir glauben, dass Diversifikation die einzige Möglichkeit ist, die Vermögensmanagern aktuell zur Verfügung steht.
Die Bedeutung von Duration und Kurvenpositionierung
Angesichts attraktiver Ausgangsbewertungen bei festverzinslichen Wertpapieren in Verbindung mit einem erwarteten schwächeren Wachstum und einer sich stabilisierenden Inflation gehen wir davon aus, dass wir tendenziell stärker übergewichtete Durationspositionen in unseren Portfolios eingehen werden, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war.
US-Staatsanleihen haben in jeder Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg als Absicherung für Portfolios gedient, da Aktien und Anleihen historisch eine inverse Korrelation aufweisen. Die qualitativ hochwertigen globalen Anleihenmärkte haben ähnliche Eigenschaften geboten.
Eine Kernthese von PIMCO bleibt bestehen: Sie besagt, dass die Renditekurven über unseren langfristigen Horizont wieder steiler werden dürften, da die Anleger weiterhin höhere „Entschädigungen“ für das Halten längerfristiger Anleihen im Vergleich zu Barmitteln und kurzfristigen Schuldverschreibungen verlangen. Die Schätzungen für die Laufzeitprämie für US-Staatsanleihen sind positiv und seit dem Jahrzehnt vor der Pandemie deutlich gestiegen. Angesichts der aktuellen Haushaltsdebatte in den USA besteht das Potenzial für eine weitere Versteilerung der Kurve.
Aktives Management kann die Rolle von Anleihen als Absicherung durch eine entsprechende Positionierung auf der Zinsstrukturkurve stärken. Wir gehen davon aus, dass wir im fünf- bis zehnjährigen Teil der globalen Renditekurven übergewichtet bleiben und im Lauf der Zeit am langen Ende untergewichtet sein werden. Angesichts der steigenden Realrenditen am langen Ende sehen wir jedoch auch eine Grenze, was den Anstieg der Laufzeitprämien angeht.
Im Fall eines starken Anstiegs der längerfristigen Renditen würden wir nämlich mit erheblichen Turbulenzen an den Aktien- und Anleihenmärkten rechnen – und das wiederum könnte die Basis für eine Abwärtskorrektur der Realrenditen legen. Wir gehen auch davon aus, dass die Zentralbanken eingreifen und ihre Bilanzen nutzen werden, falls sich abrupte Marktbewegungen zu einer umfassenden Störung der Finanzmärkte aufschaukeln sollten.
Robuste Chancen jenseits von Unternehmensanleihen
Die Kreditmärkte bieten eine Fülle von Chancen, aber sie bergen auch spezifische Risiken, was eine sorgfältige Auswahl von Sektoren und Einzeltiteln sowie einen Value-orientierten Investmentansatz erfordert.
Die Zeit seit der globalen Finanzkrise war außergewöhnlich: eine lange Expansion, die durch massive staatliche Unterstützung im Zuge der globalen Finanzkrise und der Pandemie angeheizt wurde und eine aggressive Kreditvergabe belohnte. Dies steht in krassem Gegensatz zu den Jahrzehnten unmittelbar vor der globalen Finanzkrise, in denen es in konjunkturell sensiblen Kreditbereichen weniger Unterstützung, größere Volatilität und ungleichmäßige Erträge gab.
Die Credit Spreads sind im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten trotz des langfristig größeren Rezessionspotenzials nach wie vor eng. Das deutet darauf hin, dass es an den Märkten für öffentlich gehandelte und privat platzierte Unternehmensanleihen eine gewisse Selbstzufriedenheit gibt. Die Fortschritte bei der KI könnten die Volatilität anheizen, da die Märkte für gehebelte Darlehen und private Direktkredite große Allokationen in Technologie und anderen Branchen aufweisen, die von KI-Disruptoren ins Visier genommen werden. Eine Korrektur der überzogenen Bewertungen von US-Aktien könnte auch eine umfassendere Neubewertung von Risikoanlagen auslösen. Angesichts des begrenzten fiskalpolitischen Spielraums könnte sich zum ersten Mal seit Jahren ein echter Kreditausfallzyklus entfalten – anders als in der jüngsten „Buy the Dip“-Ära – und viele Investoren unvorbereitet treffen.
In einem schwächeren Wachstumsumfeld sind qualitativ nicht so hochwertige und konjunktursensible Unternehmen Risiken ausgesetzt. Höhere kurzfristige Zinssätze könnten mittelständische Unternehmen, die sich an den Märkten für variabel verzinste Anleihen verschulden, zunehmend vor eine Herausforderung stellen. Wir bleiben vorsichtig in Bereichen der privaten Unternehmenskredite, in denen das eingesammelte Kapital die Investitionsmöglichkeiten übertroffen hat, was möglicherweise zu Enttäuschungen führen kann. Die Spannungen im Bereich Private Equity und Private Credit sind offensichtlich und könnten sich in einer Rezession noch deutlich verschärfen.
Eine weitere Konvergenz zwischen öffentlichen und privaten Märkten scheint über den langfristigen Horizont hinaus wahrscheinlich. Es gibt jedoch auch erhebliche Hindernisse für eine stärkere Konvergenz, was auf Liquidität, Transparenz, Kreditqualität und strukturelle Erwägungen zurückzuführen ist. Aktive Investmentmanager mit Zugriff auf einen breit aufgestellten, globalen „Werkzeugkasten“, der sich über öffentliche und private Märkte erstreckt, können auf Value-Verwerfungen in verschiedenen Segmenten der öffentlichen und privaten Kreditmärkte reagieren und gleichzeitig unvoreingenommene Lösungen anbieten, die die Liquidität, die tatsächliche Kreditqualität und die relativen Bewertungen berücksichtigen, um den Anlegern den besten Service zu bieten.
Strengere Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften für Banken dürften auch künftig dazu führen, dass viele Kreditvergaben in den USA auf den privaten Kreditmarkt verlagert werden, insbesondere bei vermögensbasierten Finanzierungen. Dies eröffnet Anlegern die Möglichkeit, als vorrangige Kreditgeber in Bereichen zu agieren, die einst von Regionalbanken dominiert wurden. Wir sehen weiterhin attraktive Chancen in qualitativ hochwertigen Kreditbereichen wie Konsumgüter, Wohnbaufinanzierungen, Immobilien und Sachanlagen, wo die Ausgangsbedingungen und Bewertungen im Vergleich zu Unternehmensanleihen günstig erscheinen.
Gastreferenten beim Secular Forum 2025
|
Daron Acemoglu Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften; Professor für Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology |
Laurence Boone Ehemaliger französischer Staatssekretär für europäische Angelegenheiten
|
|
Roberto Campos Neto Ehemaliger Präsident der brasilianischen Zentralbank 2019–2024 |
Seth Carpenter Chefökonom für Globalökonomik bei Morgan Stanley; ehemaliger stellvertretender Staatssekretär im US-Finanzministerium |
|
David Crane Ehemaliger Unterstaatssekretär für Infrastruktur im US-Energieministerium |
Bill Demchak CEO von PNC |
|
Robert Lighthizer Ehemaliger Handelsbeauftragter der USA 2017–2021; ehemaliger stellvertretender Handelsvertreter 1983–1985 |
Adam Posen Präsident des Peterson Institute; ehemaliges Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England |
|
Zoltan Pozsar Gründer von Ex Uno Plures; ehemaliger Zinsstratege bei Credit Suisse; ehemaliger Leiter der Markets Desk Group für Verbriefungen der New Yorker Fed |
Kevin Rudd Australischer Botschafter in den USA; ehemaliger Premierminister von Australien |
|
PIMCO’s globales Beratergremium Weltweit anerkannte Experten für wirtschaftliche und politische Fragen |
Über unsere Foren
Der Investmentprozess von PIMCO, der auf unseren Cyclical und Secular Forums basiert, ist so konzipiert, dass Portfoliomanager eine 360-Grad-Sicht auf Risiken und Chancen erhalten.